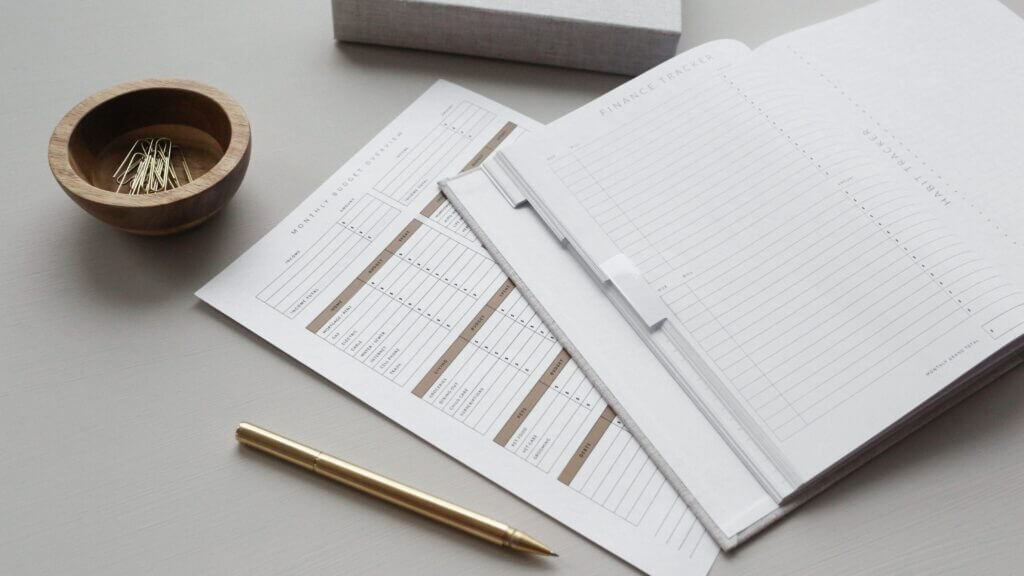Die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) ist ein mächtiges Werkzeug, das weit mehr kann, als nur große Unternehmen bei der Kostenkontrolle zu unterstützen. Für Freelancer bietet die KLR eine wertvolle Möglichkeit, finanzielle Abläufe zu optimieren, Kosten zu senken und letztlich den Gewinn zu maximieren. In diesem Artikel verraten wir, wie dieses Instrument aus dem Rechnungswesen dabei hilft, Projekte noch rentabler zu gestalten.
Was ist die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)?
Die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) ist ein essenzielles Instrument des internen Rechnungswesens, das darauf abzielt, die Kosten und Leistungen innerhalb eines Unternehmens oder eines Projekts detailliert zu erfassen, zu analysieren und zu steuern. Während die KLR traditionell in großen Unternehmen Anwendung findet, bietet sie auch für Freelancer erhebliche Vorteile.
Im Kern beschäftigt sich die Kosten- und Leistungsrechnung mit drei Hauptfragen:
- Welche Kosten fallen an? (Kostenartenrechnung)
- Wo fallen diese Kosten an? (Kostenstellenrechnung)
- Wofür fallen die Kosten an? (Kostenträgerrechnung)
Durch die Beantwortung dieser Fragen können Freelancer genau nachvollziehen, welche ihrer Aktivitäten Kosten verursachen, wie diese Kosten verteilt werden und wie sich die Kostenstruktur auf die Rentabilität ihrer Projekte auswirkt.
Deshalb sollten Freelancer die KLR durchführen
Mehr Umsatz?
Mit den Daten der größten Freelancing-Plattform im deutschsprachigen Raum zu mehr Durchblick in der Preisgestaltung.
Für Freelancer ist die Kosten- und Leistungsrechnung von entscheidender Bedeutung, da sie ihnen ermöglicht, eine detaillierte Übersicht über ihre finanzielle Situation zu erhalten und fundierte Entscheidungen zu treffen. Außerdem können Freiberufler so herausfinden, welche Projekte wirklich rentabel sind – und welche nicht. Hier sind einige Gründe mehr, warum die KLR für Freelancer so wertvoll ist:
#1: Transparenz über die eigene Kostenstruktur
Freelancer müssen ihre Kosten genau kennen, um profitabel arbeiten zu können. Die KLR hilft, alle anfallenden Kosten systematisch zu erfassen und in verschiedene Kategorien zu unterteilen. So behalten freie Mitarbeiter den Überblick über direkte Kosten wie Material- oder Dienstleistungskosten oder indirekte Kosten wie Miete und Software-Abonnements und können diese weiter analysieren.
#2: Genauere Preisfindung und Angebotskalkulation
Die KLR unterstützt Freelancer dabei, ihre Preise so zu kalkulieren, dass alle anfallenden Kosten gedeckt sind und gleichzeitig ein angemessener Gewinn erzielt wird. Durch die genaue Berechnung der Selbstkosten können Freelancer sicherstellen, dass ihre Angebote weder zu niedrig noch zu hoch angesetzt sind. Eine präzise Preisfindung ist besonders wichtig, um wettbewerbsfähig zu bleiben und langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.
#3: Wirtschaftlichkeitsanalyse von Projekten
Freelancer führen oft verschiedene Projekte gleichzeitig durch, und nicht jedes Projekt ist gleichermaßen profitabel. Die KLR ermöglicht es, die Rentabilität einzelner Projekte zu analysieren, indem sie die Kosten und den erzielten Umsatz gegenüberstellt. So lässt sich feststellen, welche Projekte lukrativ sind und welche möglicherweise nur geringe oder sogar negative Margen bieten.
#4: Optimierung der eigenen Arbeitsprozesse
Durch die Analyse der Kostenstrukturen können Freelancer ineffiziente Prozesse identifizieren und gezielt verbessern. Beispielsweise könnten sie feststellen, dass bestimmte Aufgaben zu viel Zeit und damit Geld kosten, und entsprechende Maßnahmen ergreifen, um diese Prozesse effizienter zu gestalten.
Das könnte man beispielsweise durch den Einsatz effizienter Arbeitsstrategien (z. B. Timeboxing oder Timeblocking) oder moderner Tools für die Buchhaltung erreichen.
#5: Bessere Vorbereitung auf Steuerangelegenheiten
Die KLR erleichtert die Vorbereitung der Steuererklärung erheblich, da sie eine klare Aufschlüsselung aller Kosten bietet. Dies stellt sicher, dass alle abzugsfähigen Ausgaben erfasst und korrekt ausgewiesen werden. Eine präzise Kostenübersicht kann zudem dabei helfen, steuerliche Vorteile zu nutzen und unnötige Zahlungen zu vermeiden. Etwa durch eine gezielte Abschreibung oder ein smartes Forderungsmanagement.
In 3 Stufen zur Kosten- und Leistungsrechnung
Wie bereits angeschnitten, besteht die KLR aus drei Stufen: Kostenartenrechnung, Kostenstellenrechnung und Kostenträgerrechnung. Nachfolgend erklären wir, wie jede Stufe im Detail aussieht und wie Freelancer hierbei vorgehen müssen.
1. Kostenartenrechnung: Welche Kosten fallen bei Freelancern an?
Die Kostenartenrechnung ist der erste Schritt in der KLR und befasst sich mit der Erfassung und Gliederung aller Kosten, die einem Freelancer im Rahmen seiner Tätigkeit entstehen. Diese Kosten werden in verschiedene Kategorien unterteilt, um eine klare Struktur zu schaffen.
Typische Freelancing-Kostenarten
Als Freelancer hat man in der Regel eine Vielzahl von Kosten, die man im Rahmen seiner Tätigkeit berücksichtigen muss, darunter:
- Materialkosten: Kosten für Rohmaterialien oder spezielle Werkzeuge, die für die Erbringung der Dienstleistung erforderlich sind.
- Personalkosten: Falls Freelancer Mitarbeiter beschäftigen, zählen dazu Löhne, Gehälter und Sozialabgaben.
- Mietkosten: Kosten für Büro- oder Arbeitsräume, falls nicht von zu Hause aus gearbeitet wird.
- IT- und Softwarekosten: Kosten für notwendige Softwares, Cloud-Dienste oder Hardware.
- Marketingkosten: Ausgaben für Selbstmarketing, Social Media, eine eigene Homepage und andere Maßnahmen zur Kundengewinnung.
Berechnungsbeispiel:
Nehmen wir mal an, ein Grafikdesigner möchte wissen, wie viel seine Design-Software pro Projekteinsatz kostet. Er nutzt für seine Arbeit die nicht ganz günstige Adobe Creative Cloud und zahlt pro Monat 60 Euro. Er arbeitet monatlich an drei verschiedenen Projekten.
Softwarekosten pro Projekt = (60 € : 3 Projekte) = 20 €/Projekt
Die Kostenartenrechnung – also die Antwort auf die Frage, welche Kosten fallen pro Projekt an – ermöglicht es Freelancern, regelmäßige Ausgaben zu erfassen und den jeweiligen Projekten konkret zuzuordnen.
2. Kostenstellenrechnung: Wo fallen bei Freelancern Kosten an?
Die Kostenstellenrechnung ordnet die in der Kostenartenrechnung erfassten Kosten den verschiedenen Bereichen oder „Kostenstellen“ zu. Dabei wird zwischen sogenannten Hauptkostenstellen und Hilfskostenstellen unterschieden.
Hauptkostenstellen
Unter Hauptkostenstellen bei Freelancern versteht man Tätigkeitsbereiche oder Projekte, die direkt zur Erbringung der Dienstleistungen beitragen, die der Freelancer anbietet. Die Kosten, die in diesen Hauptkostenstellen anfallen, werden direkt mit den Einnahmen aus den entsprechenden Projekten oder Dienstleistungen verrechnet. Beispiele wären etwa:
- Projektarbeit: Die direkte Arbeit an Kundenprojekten, wie z.B. das Design einer Website, das Schreiben eines Textes oder die Programmierung einer Software.
- Beratung und Coaching: Tätigkeiten, bei denen der Freelancer direkt mit Kunden arbeitet und Beratungsleistungen erbringt.
- Verkauf von Produkten: Falls der Freelancer eigene digitale Produkte wie E-Books oder Online-Kurse anbietet, wäre die Erstellung und der Vertrieb dieser Produkte eine Hauptkostenstelle.
Berechnungsbeispiel:
Ein Freelancer erstellt eine Website für einen Kunden. Die Hauptkostenstelle „Projektarbeit“ umfasst in diesem Fall:
- Arbeitszeit: 20 Stunden zu einem Stundensatz von 50 Euro = 1.000 Euro
- Materialkosten: 100 Euro für Software-Lizenzen
Gesamtkosten für die Hauptkostenstelle „Projektarbeit“ = 1.000 € + 100 € = 1.100 €
Diese Kosten werden direkt mit dem Projekt verknüpft, und der Freelancer muss sicherstellen, dass das Projekt entsprechend bepreist wird, um die Kosten zu decken und Gewinn zu erzielen.
Hilfskostenstellen
Hilfskostenstellen bei Freelancern sind Tätigkeitsbereiche oder Aufgaben, die nicht direkt zur Erbringung der Dienstleistung beitragen, aber notwendig sind, um die Hauptkostenstellen effizient zu unterstützen. Diese Hilfskostenstellen können Kosten verursachen, die zunächst nicht direkt in die Projektkosten eingehen, aber trotzdem berücksichtigt werden müssen, um ein vollständiges Bild der Kostenstruktur zu erhalten. Zum Beispiel:
- IT-Support und Wartung: Zeit und Kosten, die für die Wartung von Computern, Software-Updates oder die Verwaltung von IT-Systemen anfallen.
- Verwaltung und Buchhaltung: Aufgaben wie Rechnungsstellung, Steuererklärung, Verwaltung von Verträgen oder sonstige administrative Tätigkeiten.
- Weiterbildung: Kosten und Zeit, die der Freelancer in seine eigene Weiterbildung investiert, um seine Fähigkeiten zu verbessern und wettbewerbsfähig zu bleiben.
Die Betrachtung der Hilfskostenstellen ist wichtig, weil sie sicherstellen, dass die Hauptkostenstellen bzw. die Projekte reibungslos funktionieren. Auch wenn die Kosten in Hilfskostenstellen nicht direkt einem Projekt zugeordnet werden, müssen sie dennoch auf die Hauptkostenstellen umgelegt werden, um die tatsächlichen Kosten der erbrachten Dienstleistungen zu ermitteln.
Berechnungsbeispiel:
Ein Freelancer investiert monatlich 200 Euro in IT-Support und Wartung, um sicherzustellen, dass seine Arbeitsgeräte und Software immer auf dem neuesten Stand sind und reibungslos funktionieren. Diese Kosten werden als Hilfskostenstelle erfasst.
Wenn der Freelancer in einem Monat an zwei Projekten arbeitet, könnte er diese Kosten auf die Hauptkostenstellen (die Projekte) wie folgt verteilen:
Wartungskosten/Projekt = 200 € : 2 Projekte = 100 €/Projekt
Diese 100 Euro würden dann zu den bereits ermittelten direkten Projektkosten in den Hauptkostenstellen addiert, um die Gesamtkosten pro Projekt zu berechnen.
3. Kostenträgerrechnung: Wofür fallen Kosten an?
In der Kostenträgerrechnung werden die erfassten und zugeordneten Kosten schließlich den einzelnen Projekten oder Dienstleistungen (den Kostenträgern) zugewiesen. So können Freelancer die Gesamtkosten eines Projekts berechnen und bewerten, ob der Preis, den sie für die Leistung berechnen, die Kosten deckt und Gewinn ermöglicht. Hierbei kann man zwei unterschiedliche Verfahren anwenden:
- Kostenträgerstückrechnung: Ermittlung der Kosten für die Erbringung einer einzelnen Einheit einer Dienstleistung, z.B. die Erstellung einer Website oder Durchführung eines Workshops.
- Kostenträgerzeitrechnung: Ermittlung der Gesamtkosten für alle Projekte oder Dienstleistungen, die in einem bestimmten Zeitraum erbracht wurden z. B. für einen Monat oder ein Quartal.
Berechnungsbeispiel:
Ein Freelancer erhält den Auftrag, eine Website für einen Kunden zu gestalten. Die direkten Kosten für das Projekt umfassen 30 Stunden Arbeitszeit zu einem Stundensatz von 50 Euro sowie 20 Euro Softwarekosten, die bereits in der Kostenartenrechnung erfasst wurden.
Arbeitskosten = 30 Stunden x 50€/Stunde = 1.500 €
Gesamtkosten = Arbeitskosten + Softwarekosten = 1.500 € + 20 € = 1.520 €
Die Gesamtkosten für das Projekt betragen also 1.520 Euro. Der Freelancer muss nun sicherstellen, dass der Preis für die Website diesen Betrag übersteigt, um einen Gewinn zu erzielen.
Fazit
Mit der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) können Freelancer genau bestimmen, wann welche Kosten wofür und wo genau angefallen sind. Auf diese Weise kann man das eigene Honorar projektgenau kalkulieren – und zwar so, dass noch genügend Gewinn übrig bleibt, während alle Freelancing-Kosten gedeckt sind.